
„Wir könnten ein Buch rausbringen“
Die Anfänge des Fanprojekts der Sportjugend Berlin liegen bereits 35 Jahre zurück: Die pädagogische Arbeit mit jungen Anhängerinnen und Anhängern unserer Hertha begann 1990 – inmitten der Freude über den dritten deutschen Weltmeistertitel und der Wiedervereinigung. Die wichtige Kooperation hält bis in die Gegenwart an. Verschiedenen blau-weißen Generationen dienten die Angebote des Fanprojekts dabei als Anker. Anlässlich dieses besonderen Jubiläums und der damit verbundenen Feierlichkeiten im Haus der Fußballkulturen sprach Redakteur Erik Schmidt mit Projektleiter Ralf Busch sowie den beiden pädagogischen Mitarbeitern Thomas Jelinski und Robin Ertel über die Anfänge, den Arbeitsalltag und zahlreiche Anekdoten.
Ralf, Thomas, Robin, herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum! Was bedeutet euch dieser Meilenstein?
Ralf Busch: In allererster Linie ist es ein Beleg für unsere Arbeit. Wir heißen immer noch „Projekt“ und der Name hat sich auch so eingebrannt, aber eigentlich laufen Projekte nur über einen begrenzten Zeitraum. Dass wir nun aber schon über 35 Jahre in diesem Bereich tätig sein können und finanziert werden, ist eine sehr schöne Anerkennung unserer pädagogischen Arbeit mit Fußballfans. Mit der Senatsjugendverwaltung, dem DFB und der DFL als Finanziers, unserem Träger Sportjugend Berlin sowie unseren Bezugsvereinen Hertha BSC und dem BFC Dynamo haben wir großartige Partner, ohne die dies alles nicht möglich wäre. Insbesondere die professionelle und enge Zusammenarbeit mit Hertha BSC gehört bundesweit zu den herausragenden.
Wie sehen jeweils für euch persönlich die ersten Berührungspunkte mit dem Fanprojekt aus?
Robin Ertel: Meinen ersten Berührungspunkt gab es während des Studiums. Ich hatte einen Kurs, der Sportsozialarbeit hieß, den Thomas und Ralf als Dozenten geleitet haben. Da ich damals schon selbst Hertha-Fan war, fand ich das extrem spannend und bin dann so auch Werkstudent geworden. Bevor ich noch etwas anderes gemacht habe, war ich zudem eine ganze Weile lang als Honorarkraft tätig. Der Kontakt ist auch anschließend nie abgebrochen. Als dann eine Stelle frei geworden ist, hat mich Thomas angesprochen – ich habe mich beworben und bin glücklicherweise genommen worden. Nun mache ich das Ganze schon seit sieben Jahren, fühle mich nach wie vor sehr gut aufgehoben und habe viel Spaß bei der Arbeit.
Thomas Jelinski: Ralf und ich haben seit 1990 zusammen Volleyball gespielt. Schon damals hat er mich mehrmals gefragt, ob ich nicht Lust hätte, beim Fanprojekt anzufangen. Das war für mich zu diesem Zeitpunkt noch keine Option. Im Jahr 1994 haben mir die Kollegen die Arbeit dann aber doch schmackhaft gemacht. Daraus sind jetzt schon 31 Jahre geworden. Es macht großen Spaß, ist spannend und herausfordernd. Die Freiheit, Inhalte zu schaffen und Dinge selbst zu gestalten und das in diesem hervorragenden Team war der Grund, bis heute dabeizubleiben.
Busch: Ich bin Mitte der achtziger Jahre nach Berlin gekommen, um Soziale Arbeit zu studieren. Andreas Klose, einer der Gründer des Fanprojekts, hatte an meiner Uni einen Lehrauftrag. Das war sehr interessant, trotzdem hatte ich das Ganze dann aber zunächst wieder aus den Augen verloren. Nach dem Studium wusste ich nur, dass ich etwas mit Jugendlichen machen möchte. Durch Zufall habe ich eine ausgeschriebene Stelle vom da gerade erst gestarteten Fanprojekt gesehen und mich beworben. Obwohl ich sogar etwas zu spät dran war, konnte ich im Dezember 1990 anfangen. Ich war dann auch recht schnell Feuer und Flamme und bin es immer noch. Natürlich ist auch eine unglaubliche Nähe zum Verein entstanden, obwohl ich anfangs gar keine großen Verbindungen zu Hertha hatte.
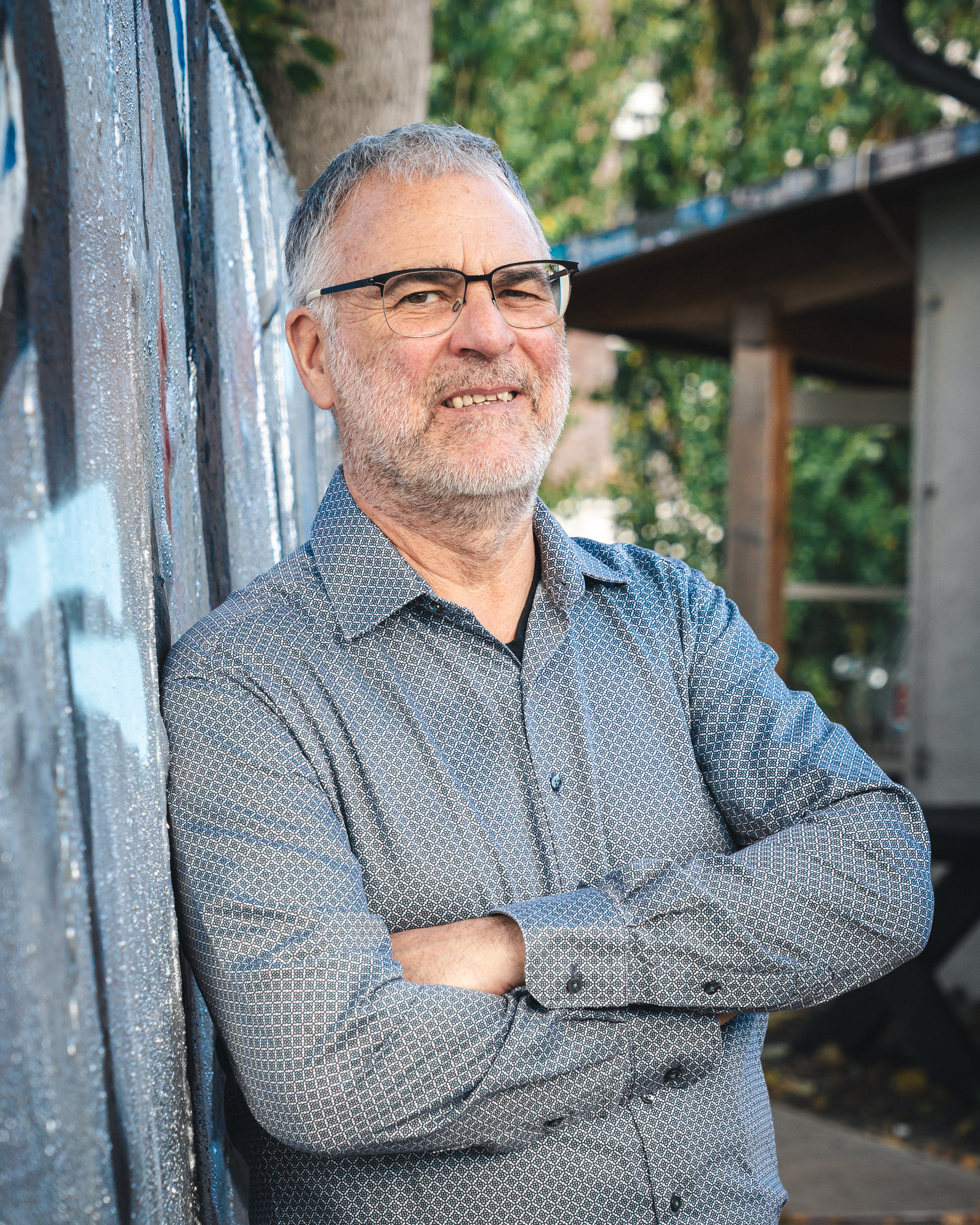
Auch wenn ihr selbst also nicht direkt involviert wart – wie kam es dazu, das Fanprojekt vor über 35 Jahren ins Leben zu rufen?
Busch: Es gab zum einen schon Mitte der achtziger Jahre ein Forschungsprojekt von Andreas Klose und Helmut Heitmann. Sie wollten die Notwendigkeit von sozialer Arbeit in diesem Bereich evaluieren und unterfüttern. Zu den Hintergründen zählten Gewalt und Rassismus. Dann ist Hertha in dieser Zeit aber abgestiegen – und alle Geldgeber haben sich zurückgezogen. Die beiden sind trotzdem drangeblieben. Zumal zwei glückliche Umstände folgten: Zum einen ist Hertha in der Saison 1989/90 wieder aufgestiegen, zum anderen hat der rot-grüne Senat das Ganze unterstützt. Das Fanprojekt wurde dann originär für Hertha gegründet. Allerdings führten die politischen Entwicklungen rund um die deutsche Wiedervereinigung dazu, dass ganz schnell auch der BFC Dynamo hinzukam. In den folgenden Jahren arbeiteten wir noch mit weiteren Vereinen zusammen. Aber spätestens seit wir im Haus der Fußballkulturen in der Cantianstraße sind, liegt der Fokus wieder ganz klar und ausschließlich auf Hertha und dem BFC.
Wie lässt sich eure Arbeit in wenigen Sätzen zusammenfassen?
Ertel: Ganz wichtig ist vor allem die Beziehungsarbeit, die speziell durch die Spieltagsbegleitung passiert. Wir decken sowohl alle Heim- als auch Auswärtspartien ab. Darüber hinaus bieten wir die Möglichkeit, Sport zu machen. Dafür stehen regelmäßige Hallenzeiten zur Verfügung. Ein anderer großer Aspekt stellt unsere Kulturarbeit dar. Diese umfasst beispielsweise Themenabende und Buchlesungen. Ein großes Glück haben wir auch mit unserem Haus der Fußballkulturen, das uns reichlich Platz für Veranstaltungen und Angebote sowie eine Graffitiwand für Workshops bietet. Dieses nutzen die aktiven Gruppen beider Vereine sehr gerne. Wir bieten dem FKO und etablierten Fangruppen die Möglichkeit, in unseren Räumen mit unserer Unterstützung Jugendtage anzubieten. Das sind unsere Kernaufgaben, zu denen dann noch die institutionelle Netzwerkarbeit kommt.
Jelinski: Wir sind in der Kooperation mit anderen Verbänden – sei es der DFB, die DFL, der Berliner Fußball-Verband oder die Bundesarbeitsgemeinschaft der Fanprojekte. Es gibt bundesweit 72 Fanprojekte, die so oder ähnlich arbeiten wie wir. Da findet ständig eine kollegiale Beratung statt. Auch mit der Polizei treffen wir uns in regelmäßigen Abständen und tauschen uns aus, um Themen und Interessen im Sinne der Fans zu besprechen.
Wie sieht euer Arbeitsalltag aus?
Jelinski: Es gibt keine klassische Routine, höchstens an Spieltagen – das macht es aus, hier zu arbeiten. Grundsätzlich treffen wir bestimmte Vorbereitungen, bearbeiten unterschiedliche Projekte und koordinieren Termine. Alles in allem ist die Arbeit sehr abwechslungsreich und jeder Tag anders. Zudem kann es immer Überraschungen geben.
Wie gestalten sich speziell die Spieltage?
Busch: Auch sehr unterschiedlich. Vieles macht die Fanbetreuung, mit der wir sehr eng zusammenarbeiten. Wir unterstützen meist zusätzlich. Wenn nichts Außergewöhnliches passiert, dienen die Spieltage vor allem zur Beziehungsarbeit und zum Beobachten von Dingen. Wenn es doch zu Problemen kommt, können wir intervenieren und versuchen, mit Einsatzleitern, Fanbetreuern oder den anderen Fanprojekten zu sprechen und zu vermitteln.
Jelinski: Es gibt immer mal wieder Ereignisse, die es nötig machen, weiter dranzubleiben. Als Stichworte: Dortmund, Polizeibanner oder Osnabrück. Das sind Folgearbeiten, bei denen es um Anhörungen oder aber Konsequenzen geht. Wir begleiten beispielsweise bei Sozialstunden und vermitteln bei Stadionverboten. Dabei sind wir nicht die, die das entscheiden, und grundsätzlich gegen Stadionverbote – aber wir erklären der einen Seite jeweils, wie die andere tickt und welche Beweggründe es gibt und gab. Transparenz ist dabei ganz entscheidend und verspricht den größten Erfolg, was Verständnis für und Akzeptanz von Entscheidungen angeht.
Ertel: Sozialstunden können direkt bei uns abgeleistet werden. Dann geht es eben auch darum, sich mit der Tat auseinanderzusetzen und das Ganze abzuarbeiten.
Jelinski: Dabei ist uns vor allem der pädagogische Ansatz sehr, sehr wichtig. Damit haben wir auch gute Erfahrungen gemacht.

Was hat sich im Laufe der Zeit an eurer Arbeit positiv und vielleicht auch negativ entwickelt?
Jelinski: Da lässt sich die Professionalisierung der Polizei nennen – und sich so und so betrachten. Als normaler Fan bekommt man das Gefühl, dass es im Stadion sicherer als früher zugeht. Aber oft bietet genau das auch unnötige Reibungsflächen. Das ist eine leidige Diskussion, die uns begleitet. Zumindest hat sich die gemeinsame Kommunikation aber so entwickelt, dass es Mittel und Wege gibt, um bestimmte Dinge anzusprechen.
Busch: Mir fällt noch ein anderer Punkt ein. Gerade in den neunziger Jahren wurden Projekte wie unseres immer wieder infrage gestellt, wenn es irgendwo im Stadion zu Gewalt kam. Wir haben aber eigentlich zwei Säulen: Das Nationale Konzept für Sport und Sicherheit und die Jugendarbeit, basierend auf dem Sozialgesetzbuch VIII. Demzufolge arbeiten wir nicht nur problem- und defizit-, sondern auch ressourcenorientiert. Das heißt, wir beschäftigen uns auch mit Menschen, die keine Probleme machen. Es geht also genauso darum, positive Kräfte zu stärken. Da mussten wir uns oft reduzieren lassen. Doch das hat sich geändert, würde ich sagen. Wir und unsere Arbeit sind inzwischen deutlich anerkannter und abgesicherter.
Du hast die Arbeit mit den Menschen angesprochen. Worauf kommt es im Umgang mit jungen Leuten vor allem an?
Ertel: Die Menschen, mit denen wir arbeiten, sind ein ganz wichtiger Punkt des Berufs. Sie bilden einen Querschnitt der Gesellschaft ab, was die Aufgabe besonders spannend macht. Man sollte mit ihnen so umgehen, wie mit allen anderen Menschen auch: Respektvoll und auf Augenhöhe.
Busch: Man muss viel zuhören, weniger bewerten und belehrend sein – trotzdem sollte man generell eine Haltung haben. Das ist auch den Jugendlichen ganz wichtig. Außerdem sollte man immer offen für Neues sein. Es gibt nie so richtig Stillstand. Das macht den Reiz aus.
Jelinski: Eine gewisse Neugierde ist entscheidend. Speziell für Jugend- und Subkulturen – ohne Vorbehalte, auch im Umgang mit Menschen, die vielleicht anders sind, als wir uns das wünschen. Wir müssen sie so akzeptieren, wie sie sind und dann Schritt für Schritt daran arbeiten.
An welche Ereignisse oder Persönlichkeiten denkt ihr jeweils besonders gerne zurück? Welche Anekdoten sind in euerer Erinnerung am präsentesten?
Ertel: Ich würde da an das Thema der Professionalisierung der Polizei anknüpfen. Für mich war es sinnbildlich, als wir im Jahr 2019 mit Hertha bei einem Testspiel gegen Crystal Palace in London waren. Dort haben sich über 600 Herthaner auf der Straße in einem Pub getroffen. In Deutschland wären bei dieser Ausgangslage mindestens 100 Polizisten dabei gewesen, in England waren es aber genau zwei. Sie haben das Gespräch gesucht und der Gruppe dann ermöglicht, zum Stadion zu laufen. Es kam nur noch ein zusätzliches Auto hinzu und trotzdem ist alles friedlich geblieben. Da sieht man, dass das Klischee des bösen und pöbelnden Fußballfans, nicht ganz so stimmt. Das ist für mich immer noch eine ganz besondere Geschichte.
Jelinski: Natürlich drängt sich Kay (Bernstein, Anm. d. Red.) bei dieser Thematik auf. Insofern, dass wir ihn im Alter von 15 Jahren in Hohenschönhausen, wo wir zu dieser Zeit unseren Standort hatten, bewusster wahrgenommen haben. Die Anfänge mit ihm waren so, wie sie mit vielen sind, die in der Pubertät nach Reibungsflächen suchen und dadurch gewisse Probleme bekommen. Über die Jahre hat sich eine unglaublich hohe Wertschätzung entwickelt – auch vor dem, was Kay geschafft und geleistet hat. Wir durften das immer begleiten und beobachten. Denn er hat viel Zeit bei uns verbracht und dabei zu vielen Themen unseren Rat gesucht. So an seinem Leben teilgehabt haben zu dürfen, ist für mich eine ganz besondere Geschichte.
Busch: Da kann ich mich nur anschließen. Darüber hinaus gibt es viele kleine Geschichten. Mir fällt beispielsweise eine ein, als ein Fan im Jahr 1991 von einer Reise aus Italien zurückkam und beim Auswärtsspiel in Hannover zwei Nebeltöpfe dabeihatte. Er hat mich gefragt, ob er die denn zünden dürfte. Zu dieser Zeit gab es das nämlich noch gar nicht in Deutschland. Dann sind wir gemeinsam zum Einsatzleiter der Polizei gegangen, der grünes Licht gegeben hat. Der Fan hat anschließend wie besprochen ganz unten im Block gezündet. Allerdings stand der Wind so schlecht, dass der Rauch nicht abzog und der Schiedsrichter das Spiel für mehrere Minuten unterbrechen musste. Deswegen kam der Fan völlig verzweifelt auf mich zu und bat darum, in der Halbzeitpause in die Sprecherkabine zu gehen, um sich bei den anderen Leuten im Stadion über das Mikrofon zu entschuldigen. Das haben wir tatsächlich auch geschafft.
Jelinski: Ich glaube, wir könnten ein Buch rausbringen: Die 100 Anekdoten des Fanprojektes (lacht).
Welche waren und sind in eurem Beruf die größten Herausforderungen?
Jelinski: Wenn ein Spieltag ruhig verläuft, dann freue ich mich und kann das auch sehr genießen. Aber ich finde es auch interessant, wenn etwas passiert. Einfach, weil daraus immer Lerneffekte entstehen und ich meine Bandbreite des Handelns erweitern kann. Da spielt das Polizeiverhalten eine sehr große Rolle. Diesbezüglich leiten wir auch Seminare, in denen wir mit angehenden Polizisten des gehobenen Dienstes über bestimmte Situationen sprechen.
Ertel: Ansonsten lassen sich die Herausforderungen nicht planen. Aber genau das ist der Reiz des Berufs.
Busch: Neue Entwicklungen stellen immer auch eine Herausforderung dar. Für mich ist das insbesondere alles, was mit Social Media zu tun hat. Das ist mir in weiten Teilen doch sehr fremd. Darüber hinaus natürlich auch der immer größer werdende Altersunterschied.
Jelinski: Aber wir verstärken uns regelmäßig mit jungen Praktikanten. So wie sie auf die Dinge gucken und mit bestimmten Themen umgehen, erweitert das auch unsere Wahrnehmung.

Wie erlebt ihr die Zusammenarbeit mit Hertha BSC?
Ertel: Es ist eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe, die echt klasse ist.
Jelinski: Das gegenseitige Vertrauen ist sehr wichtig. Auf einer strukturellen Ebene betrachtet sind das Verhältnis und der Austausch über die Jahre immer besser geworden. Herausfordernd, aber immer angenehm.
Busch: Wir sind irgendwie angekommen und haben nicht nur mit der Fanbetreuung zu tun, sondern auch mit anderen Abteilungen. Dadurch werden wir als ein wichtiger Bestandteil wahrgenommen, von dem der ganze Verein, aber genauso wir als Projekt profitieren. Das betrifft auch Themenfelder wie historische Aufarbeitungen. Von daher ist diese Zusammenarbeit Gold wert!
Ertel: Wir sind auch gemeinsam gewachsen und arbeiten sehr eng miteinander. Ein gutes aktuelles Beispiel ist das Projekt zu Bram Appel, welches wir gerade zusammen realisiert haben. Oder wenn beispielsweise neue Fanclubs gegründet werden, treffen die sich auch bei uns im Haus.
Wie intensiv verfolgt ihr den laufenden Gerichtsprozess zum fehlenden Zeugnisverweigerungsrecht in der Sozialarbeit rund um den Karlsruher SC? Welchen Standpunkt nehmt ihr diesbezüglich ein?
Jelinski: Wir stehen natürlich voll hinter den betroffenen Kolleginnen und Kollegen. Das Thema begleitet uns im Prinzip schon immer. Wir haben demzufolge ein großes Interesse daran, dass das rechtlich auf einer Ebene behandelt wird, auf der wir uns nicht strafbar machen. Dabei geht es auch um eine Handlungssicherheit. Auf der anderen Seite gibt es die Reaktion der Fanszene, dass sie uns schützen will und uns deswegen bestimmte Dinge nicht erzählt. Damit wir gar nicht erst in die Situation kommen, gegenüber ermittelnden Behörden in Probleme zu geraten. Das, was die drei Kolleginnen und Kollegen aus Karlsruhe da erlebt haben, ist irgendwie auch sehr verrückt und bemerkenswert. Zumal sie für sich entschieden haben, das durchzuziehen. Natürlich würden wir auch sagen, dass wir das bis zur Beugehaft aushalten würden. Aber nichtsdestotrotz gibt es in der Theorie da eben einen gewissen Abstand. Sie erleben es tatsächlich. Die Belastung ist enorm.
Busch: Es ist eine verfahrene Situation. Dabei geht es schon längst nicht mehr um die Aussagen. Die Staatsanwaltschaft hat nun eine Anzeige wegen Strafvereitlung daraus gemacht, weil sie eben nicht ausgesagt haben. Es zermürbt schon. Das hat auch weitreichende Auswirkungen und für viel Wirbel gesorgt. Niemand geht gerne wegen der Arbeit in den Knast – das kann man wohl so sagen.
Jelinski: Für mich weiß ich aber: 31 Jahre – da ist eine ganz starke Bindung zu den Fans, zu Personen, zu Gruppen entstanden. Sodass ich mit meiner Überzeugung anders herangehe und sage: Das Vertrauen und das Verhältnis, das wir haben, sind absolut schützenswert. Die Entscheidung bei Berufsanfängern könnte da logischerweise eine andere sein.
Ertel: Diese Nähe entsteht aber sehr schnell. Demzufolge wäre das eigentlich undenkbar.
Abschließend: Welche Wünsche habt ihr für die Zukunft?
Jelinski: Für Ralf und mich rückt die Rente näher. Da wäre mein Wunsch natürlich der, dass die Arbeit als solche weiter anerkannt und respektiert, zudem auch gewollt wird. Dass die Finanzierung weiterläuft. Und dass es immer wieder Arbeitsbereiche, Themen, Ideen und Möglichkeiten gibt, um bei Hertha mit den Fans, mit den Leuten tolle Sachen zu machen und viel zu erleben.
Ertel: Der Umbruch wird für mich auch eine wichtige Zeit. Beide sind definitiv nicht zu ersetzen. Ich hoffe aber auch, dass es in Zukunft weiterhin Menschen gibt, die in diesem Berufsfeld arbeiten wollen und mich dann auch unterstützen.
Busch: Es ist nicht so, dass ich sagen werde: Jetzt ist gut für mich und der Betrieb läuft trotzdem weiter – oder auch nicht. Nein, ich merke schon, dass es etwas Eigenes ist. Wo ich viel Herzblut reingesteckt habe und natürlich sehen möchte, dass es gut weitergeht. Da wäre es natürlich grandios, wenn wir als kleines Team ein gutes Händchen haben, um Menschen zu finden, die da Bock draufhaben und ebenso langfristig dabeibleiben.
